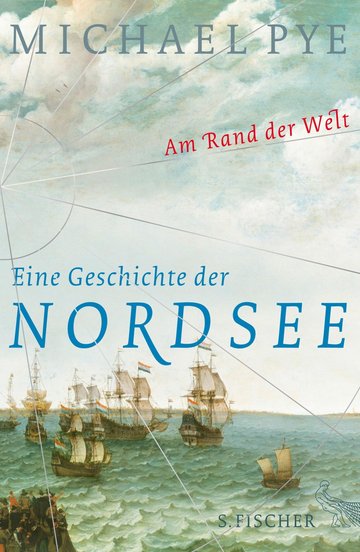Einleitung
Im Sommer des Jahres 1700 fuhr Cecil Warburton ans Meer – zwei Wochen wollte er an der Ostküste Englands verbringen, in Scarborough, auf halbem Wege zwischen Hull und Newcastle gelegen. Er war überhaupt nicht beeindruckt.
Warburton war ein Gentleman aus dem Norden, Sohn eines Baronet aus Cheshire, und er tat, was Gentlemen in einem Heilbad taten: Er trank fast jeden Tag zweieinhalb Liter des berühmten Heilwassers, das nach Tinte roch und säuerlich schmeckte, und sein ganzer Körper wurde ordentlich durchgespült. Er weigerte sich allerdings, es den übrigen Badegästen gleichzutun und die volle Menge zu trinken, die gut viereinhalb Liter betrug. An seinen Schwager schrieb er: »Ich hatte gehofft, hier etwas zu finden, das meinen Brief ein wenig unterhaltsam machen könnte, aber ich wurde enttäuscht, denn ich sehe nur Angelhaken und trocknende Fische, die hier die einzige Ausstattung ihrer Straßen und Häuser drinnen wie draußen darstellen.« Die Straßen seien übersät mit »Fischabfällen und Kabeljauköpfen … Ich hoffe, der Brief stinkt nicht danach, denn ich habe das Gefühl, dass nichts mehr frei davon ist.«[1]
Er hatte die Stadt ausgewählt, in der die Idee des Seebades geboren wurde und in der bald schon die ersten Umkleidekabinen am Strand auftauchen sollten, einen Ort, in den man kam, um zu flirten und um gesehen zu werden. All die Dinge, die mit der Arbeit am und auf dem Meer zusammenhingen, wollte er nicht sehen. Leute von »Adel, Rang und Stand«, wie es im Reiseführer für 1733 hieß, trafen sich in Scarborough: Earls und Baronets, Ladys und Marquises. Sie tranken und aßen und tranken, denn sie wussten, dass dieses Heilwasser sie reinigen und bei guter Gesundheit halten würde. Sie badeten im kalten Meer, veranstalteten Pferderennen auf den langen weißen Sandstränden und besuchten am Abend einen Ball.[2]
Sie sahen sich lieber das Kurbad an und nicht die Stadt der arbeitenden Leute, auch nicht die Burg, von der aus man nur fünfzig Jahre zuvor noch auf feindliche Schiffe gefeuert hatte, als Holländer und Engländer im Krieg miteinander lagen, nicht die aus gut dreihundert Schiffen bestehende Fischereiflotte und auch nicht den Hafen, den einzigen bei schlechtem Wetter brauchbaren Zufluchtsort zwischen dem River Tyne im Norden und dem River Humber im Süden. Die Stadt erinnerte an das Netz der vielfältigen Verbindungen, die das Meer überspannten: Nahrung, Handel, Krieg, Ankünfte und Invasionen jeglicher Art, darunter auch die von Ideen.
Cecil Warburton hatte, wie Millionen Besucher nach ihm, daran kein Interesse. Er hatte andere Sorgen. In einem Brief an seine Schwester klagte er: »Ich bin immer noch so fett wie zuvor …«[3]
Dieses neue Bild der Küste steht heute zwischen uns und der Geschichte des Meeres.[4] Die Küste wurde zu einem eigenständigen Reiseziel. Sie war nicht mehr nur der Hafen, von dem aus man zu anderen Zielen jenseits des Meeres aufbrach. Und sie wurde zu einem Ort des Spiels und der Freizeit statt der Arbeit und des Krieges. Man konnte sich kaum noch vorstellen, dass es einmal eine Welt gegeben hatte, in deren Mittelpunkt das Meer stand. Über die Jahre hatte man sogar die Küstenlinie fixiert, wie es zuvor nie gewesen war, als kräftige Winde einen Sandsturm entfachen und Sturmfluten tief ins Land vordringen konnten. Aus Stein und später Beton errichtete man Ufermauern, Promenaden, Esplanaden – eine endgültige Grenze zwischen Mensch und Meer. Dahinter konnten Hotels und Villen in völliger Gleichgültigkeit hinaus auf das Meer blicken, dem sie doch eigentlich ihren Reiz verdankten.
Das alles steckte zu Warburtons Zeiten noch in den Anfängen. In Scarborough zahlte die feine Gesellschaft fünf Schilling und trug sich ins Gästebuch ein, um die zwei am Strand erbauten Räume für Getränke und Gesellschaft, zum An- und Auskleiden zu benutzen. Manche kamen mit der Kutsche aus London hierher nach Norden, über York oder, wegen der Sehenswürdigkeiten, über Cambridge, aber nur wenn sie die Landgasthäuser ertragen konnten. Andere zahlten eine Guinee für die Fahrt mit einem der Kohlenschiffe, die von den Docks in Billingsgate leer zum Tyne zurückfuhren und in Scarborough Station machten.
Die Frauen badeten separat unter dem Schutz von Fremdenführern. Ein einheimischer Dichter klagte: »Ein weites Hemd die Nymphe schützt / vor Neugier und vor jedem Blick.« Die Männer konnten sich entweder »zurückziehen und sich in einiger Entfernung von der Badegesellschaft ausziehen … oder mit einem Boot ein wenig hinausfahren« und dann »nackt ins Wasser springen«. Das Meer galt als sicher genug für erfrischende Übungen oder medizinische Bäder. Der anonyme Autor von A Journey from London to Scarborough behauptete sogar: »Die Vorzüge, die unsere Ärzte kalten Bädern ganz allgemein zuschreiben, verstärken sich noch durch den zusätzlichen Salzgehalt des Meerwassers, ein Vorteil, dessen sich in England kein Kurort außer Scarborough rühmen kann.«
Dem Meerwasser schrieb man ähnlich heilende Wirkungen zu wie den Heilquellen. Manche Ärzte zeigten sich sogleich tief besorgt und sahen im Wasser einen Konkurrenten für die von ihnen verschriebenen chemischen Arzneimittel. Offensichtlich bedurfte es einer »genaueren Analyse der Heilwässer«, wie Dr. Simpson 1669 schrieb, einer »chemischen Anatomie«, die zeigte, welche chemischen Arzneistoffe darin enthalten waren. Nur dann könne das Meer die Billigung und Anerkennung der Ärzte finden. Als solche Analysen in den 1730er Jahren vorlagen, wurde das Meerwasser zum Gegenstand bürgerlichen Stolzes und allgemeinen Interesses, und die freundliche Banalität des Seebads bekam etwas Bedeutendes. In Scarborough besuchten nun Gäste wie Einheimische öffentliche Vorträge, in denen genauestens dargelegt wurde, was sie da tranken.[5]
Manche Wässer waren zuvor schon Gegenstand eines anderen Glaubens gewesen: heilige Wässer, heilige Quellen und Brunnen, die Heilige oder andere hoffnungsvolle Amateure gefunden hatten. Die Quelle in Scarborough, so schrieb ein Dr. Wittie 1667, war von einer Mrs Farrow entdeckt worden, die in den 1620er Jahren am Strand entlangwanderte und bemerkte, dass manche Steine durch eine hörbar sprudelnde Quelle am Fuß einer »außerordentlich hohen Klippe« rostrot verfärbt waren. Der Geschmack des Quellwassers gefiel ihr. Sie glaubte, es werde den Menschen guttun.
Die Nachricht verbreitete sich.
Dr. Wittie schrieb ein Büchlein, um sicherzustellen, dass dieses Wasser von Ärzten verschrieben wurde. Er glaubte bereits an den Nutzen von Bädern, denn genau das taten die Engländer in ihren Kurorten: Sie tranken das Wasser, aber sie badeten auch darin – im Unterschied zu den Festlandeuropäern, die das Trinken für ausreichend hielten. Er riet Männern mit einer Vorliebe für Portwein, im Meer zu baden, denn auf diese Weise habe er seine eigene Gicht geheilt, durch »häufiges Baden im kalten Meerwasser, im Sommer …, und danach schwitze ich in einem warmen Bett«. Die Sommermonate seien die besten. Dass man »in deutschen Kurorten im Winter« trank, schockierte Dr. Wittie.
Ihm war allerdings klar, dass »viele die Kurorte nicht aus Notwendigkeit, sondern zum Vergnügen besuchen, um sich eine Weile ihren ernsthaften Beschäftigungen zu entziehen und sich mit ihren Freunden zu trösten«. Aber auch aus dem Vergnügen konnten die Ärzte ein Geschäft machen: ein moderner Berufsstand, der Anspruch auf möglichst weite Teile des Lebens erhob. Das Baden war nun keine bloß vergnügliche Unternehmung mehr. Dr. Robert White schrieb 1775 über »Gebrauch und Missbrauch von Meerwasser« und warnte: »Wer im Vollbesitz seiner Gesundheit und seiner Kräfte ist, sollte sich solchen Freizeitbeschäftigungen nicht allzu intensiv hingeben.« Er könne vielleicht früh am Morgen baden, aber nervösere Fälle sollten bis »kurz vor Mittag« warten, und »niemand sollte länger als eine Minute im Wasser bleiben«. Das Meerwasser sei vielleicht kein so heftiger Schock wie eiskaltes Quellwasser, aber dennoch fühlte Dr. White sich verpflichtet, vor den »fatalen Folgen des Badens für gesunde Menschen« zu warnen. Er berichtete von einem Mann, »etwa vierzig Jahre alt, der ein gesundes und maßvolles Leben geführt hatte und überredet wurde, im Meer zu baden«. Der Mann hielt sich selbst nicht für krank und ging ohne Aderlass, ohne Darmentleerung und ohne ärztliche Anweisung ins Wasser. Die Folgen waren, so erklärte Dr. White, »ein heftiger Schmerz, der durch seinen Kopf schoss, starke Benommenheit und ein tödlicher Schlaganfall«.
Das Meer sei indessen »nützlich« bei Lepra, »von großem Nutzen« bei Epilepsie und ein Mittel gegen Gelbsucht. Es könne den Tripper heilen – wahrscheinlich eine gute Nachricht für die Schürzenjäger unter den Gentlemen, aber wohl kaum ein Trost für die nächste Person, mit der sie schliefen. Dr. White meinte, die Menschen gingen nicht sorgsam genug mit einer »so allgemeinen und beliebten Medizin« um, denn »Magen und Eingeweide werden dadurch in ständiger Erregung gehalten«. Er verzeichnete eine »Neigung, im Meer zu baden, die Menschen jeglichen Standes entwickelt« hätten.
Das galt nicht allein für die Engländer. Die Holländer unternahmen im 17. Jahrhundert Spaziergänge am Strand, in Scheveningen warfen die Jungen die Mädchen alljährlich im Frühjahr ins Wasser, und alle tranken. Ihr mit einem Fürsten vergleichbarer...