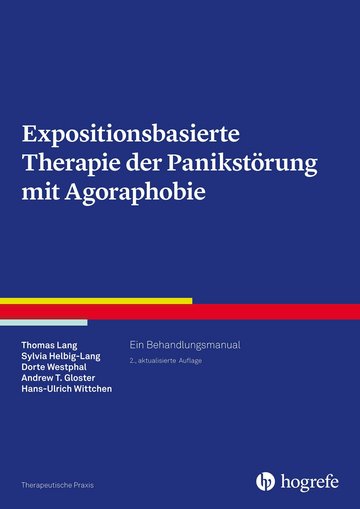|25|Kapitel 2
Störungsmodelle
2.1 Biologische Modelle
Die Anerkennung der Panikstörung als eigenständiges Störungsbild geht auf Arbeiten von Donald F. Klein zurück. Er beobachtete, dass Angststörungen, die mit Panikattacken einhergehen, auf eine Behandlung mit Imipramin ansprechen, während das bei Angststörungen ohne Paniksymptome nicht der Fall ist (Klein, 1964). Klein schloss daraus, dass Panikattacken und nicht panikbezogener Angst verschiedene pathogene Prozesse zugrunde liegen. Die Panikstörung wurde als genetisch vermittelte, neurochemische Störung konzipiert, die zu plötzlichen und episodisch auftretenden Erregungsanstiegen führt. Die von Klein postulierte Unterscheidung wurde in weiterführenden Arbeiten zur Differenzierung von „fear“ und „anxiety“ ausgebaut, die viel zum heutigen Verständnis von Angststörungen beigetragen hat (vgl. Barlow, 2002). Als Alternative zu biologisch determinierten respiratorischen Auffälligkeiten formulierten Goldstein und Chambless (1978) die Theorie der „interozeptiven Konditionierung“, nach der Unregelmäßigkeiten in der Atmung durch klassische Konditionierungsprozesse mit Angst gekoppelt werden.
Klein erweiterte seine Überlegungen später zur sogenannten „False suffocation alarm“-Theorie (Klein, 1993). Diese Theorie geht davon aus, dass zumindest einige Panikattacken durch ein im Gehirn lokalisiertes Monitoring-System ausgelöst werden, das fälschlicherweise einen Mangel an Sauerstoff meldet und dadurch eine Reaktionskaskade auslöst, die zu Hyperventilation, Panik und einer Fluchtreaktion führt. Hyperventilation, die zumindest bei einigen Panikpatienten beobachtet werden kann, wird dabei als eine kompensatorische Reaktion auf den vermuteten Sauerstoffmangel angesehen. Die Ursache der Fehlalarme vermutete Klein dabei in einer Übersensitivität für einen ansteigenden Kohlendioxid-Gehalt im Blut.
Der Vorschlag von Klein regte eine Reihe von Forschungsarbeiten an, die jedoch die Annahmen der Theorie eher infrage stellten als sie stützten. Panikprovokationsstudien zeigten beispielsweise übereinstimmend, dass provozierte Panikattacken nicht spezifisch für Patienten mit Panikstörung waren, wie es die Annahme einer zugrunde liegenden biologischen Dysfunktion bei Panikstörung nahelegen würde. Auch die Annahme einer Fehlregulation des Atmungssystems wurde verschiedentlich infrage gestellt. Respiratorische Symptome treten bei Patienten mit Panikstörung zwar häufig und sehr intensiv auf, sie sind jedoch nicht spezifisch. Im Vergleich von Patienten mit Panikstörung und Personen mit nicht klinischen Panikattacken trennten beispielsweise kognitive Symptome, wie Angst zu sterben, die Gruppen deutlich besser als respiratorische Symptome (Vickers & McNally, 2005).
Auch wenn die Annahmen der Theorie heute als weitgehend falsifiziert zu betrachten sind, sind die Arbeiten von Klein als wesentliche Forschungsimpulse zu würdigen. Klein begründete darüber hinaus die amerikanische Sichtweise der Agoraphobie als eine Folgeerscheinung der Panikstörung und bestimmte so erheblich die diagnostische Einordnung der Agoraphobie im DSM, die erst kürzlich revidiert wurde (vgl. Kapitel 1). Er formulierte, dass Personen, die wiederholt unter plötzlichen Panikattacken leiden, Erwartungsangst vor den Attacken entwickeln, auf die wiederum mit Vermeidung reagiert wird.
Neuere biologische Modelle gehen davon aus, dass der Entstehung von Panikstörungen neuroanatomische Auffälligkeiten zugrunde liegen. Ein spezifisches Modell ist dabei die neuroanatomische Theorie der Panikstörung von Gorman (Gorman, Kent, Sullivan & Coplan, 2000). Die Theorie geht davon aus, dass Patienten mit Panikstörung vermutlich genetisch bedingt eine geringere Schwelle zur Aktivierung des |26|sogenannten Furchtnetzwerks aufweisen und daher Fehlalarme im Furchtzentrum des Gehirns ausgelöst werden, die dann eine autonome Aktivierung, u. a. einen Anstieg der Atem- und Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Muskelspannung nach sich ziehen. Das Furchtnetzwerk umfasst dabei neben der Amygdala, Bereiche des präfrontalen Kortex, der Insula und den Thalamus, sowie Leitungsbahnen zum Hirnstamm und zum Hypothalamus. Evidenz für diese Annahmen stammt v. a. aus Bildgebungsstudien, die zeigen konnten, dass während des Furchtlernens die entsprechenden Hirnareale aktiviert werden (z. B. Frederikson, Wik, Fischer & Anderson, 1995).
Die neuroanatomische Theorie nimmt an, dass die weitere Störungsentwicklung auf Konditionierungsprozessen beruht. Demnach werden Informationen aus bedrohlich erlebten Situationen (z. B. der erste Panikanfall) im Hippocampus gespeichert, der wiederum unmittelbar mit der Amygdala verbunden ist. Situative Faktoren werden so mit dem Erleben von Angst verknüpft und ein Wiederaufsuchen der entsprechenden Situationen aktiviert auch das Furchtnetzwerk und die darauf folgende Vermeidungsreaktion (Gorman et al., 2000).
2.2 Das kognitive Modell
Auf Basis der Beobachtung, dass sich große individuelle Unterschiede in der Reaktion auf Panikprovokationstests zeigten, schlug David Clark vor, dass nicht die reinen körperlichen Vorgänge und Veränderungen für die Auslösung von Panikattacken verantwortlich sein können, sondern dass kognitive Bewertungen die Reaktion auf die Körpersymptome vermitteln (Clark, 1986). Nach seinem kognitiven Modell der Panikstörung kommen Panikattacken durch katastrophisierende Bewertungen körperlicher Empfindungen zustande, wobei diese körperlichen Symptome sowohl Teil der normalen Angstreaktion sein oder auch von anderen Empfindungen herrühren können. Clark illustrierte seine Überlegungen anhand eines Teufelskreises, der in Abbildung 2 dargestellt wird.
Abbildung 2: Das kognitive Modell der Panikattacke nach Clark (1986, S. 463)
Nach dem Modell können verschiedene Reize als Auslöser für eine Panikattacke fungieren. Externale Reize beinhalten situative Trigger, wie das Betreten eines engen, vollen Fahrstuhls. Häufiger werden jedoch internale Reize, wie Atemnot oder Herzrasen aufgrund körperlicher Anstrengung oder emotionaler Erregtheit als Auslöser fungieren. Werden diese Reize als gefährlich bewertet, wird eine ängstliche Erwartung ausgelöst, die von einer Reihe körperlicher Veränderungen begleitet wird. Werden diese Symptome dann wahrgenommen und ebenfalls als bedrohlich interpretiert, entsteht ein Aufschaukelungsprozess körperlicher Symptome, der schließlich in der Panikattacke mündet.
Das Modell erhebt den Anspruch, sowohl unerwartete Panikattacken als auch situationsbegünstigte Attacken erklären zu können. Letzteren geht ein Anstieg der Erwartungsangst in Situationen voraus, in denen der Betroffene schon einmal Panik erlebt hat. Beim Aufsuchen der Situation sind daher körperliche Symptome wahrscheinlicher, die aufgrund der Tendenz zur Selbstbeobachtung dann auch schneller wahrgenommen und fehlinterpretiert werden. |27|Bei unerwarteten Panikattacken liegt der Auslösereiz häufig in körperlichen Symptomen, die durch andere emotionale Zustände (Aufregung, Ärger), körperliche Anstrengung oder Substanzkonsum (z. B. Koffein) entstehen.
Das kognitive Modell hatte großen Einfluss auf die weitere Modellentwicklung und die Therapie der Panikstörung. Tatsächlich konnten einzelne Modellannahmen empirisch bestätigt werden. So neigen Patienten mit Panikstörung stärker als andere Gruppen dazu, körperliche Empfindungen katastrophisierend zu bewerten (Khawaja & Oei, 1998). Entsprechend konnte auch nachgewiesen werden, dass wesentliche Befürchtungen mit der Art der erlebten Paniksymptome korrespondieren (Salkovskis, Clark & Gelder, 1996). In verschiedenen experimentellen Studien zur Panikprovokation mit biologischen Challenges konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass die Auslösung von Panikattacken tatsächlich durch Bewertungsprozesse vermittelt wurde (vgl. Kasten).
Panikattacken werden durch Bewertungsprozesse vermittelt
Sanderson, Rapee und Barlow (1989) ließen im Rahmen eines Panikprovokationstests 20 Patienten mit Panikstörung für 15 Minuten Luft mit 5,5 % CO2-Gehalt einatmen. Die Probanden wurden instruiert, dass sie über einen Knopf den Gehalt des CO2 verringern könnten, sobald ein Licht während des Tests aufleuchte. Nur bei der Hälfte der Probanden wurde das Licht während des Tests eingeschaltet; in der anderen Gruppe leuchtete das Licht nie auf. Tatsächlich konnte in keiner Gruppe die Menge des CO2 beeinflusst werden; der Knopf war inaktiv. Trotzdem erlebten Patienten, die glaubten, ...