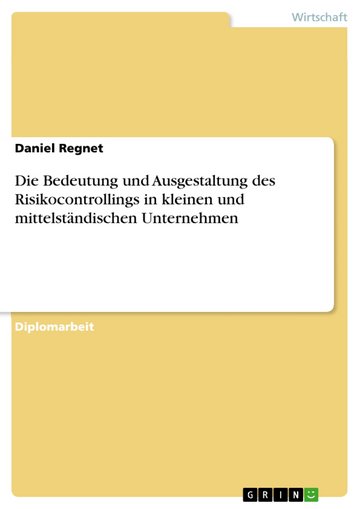Wie in der Einleitung bereits angedeutet wurde, haben sich die internen und externen Rahmenbedingungen unternehmerischer Aktivitäten hinsichtlich Komplexität und Dynamik grundlegend im Laufe der Zeit verändert (Diederichs 2004, S. 1). Diesen Faktoren sind auch KMU unterworfen mit den daraus resultierenden Risiken, Anforderungen und Problemen. Aber auch KMU-spezifische Risikofaktoren, die vorwiegend in deren qualitativen Merkmalen begründet sind, können zur Entwicklung von Risiken beitragen und machen einen verstärkten Umgang mit Risiken auch in diesen Unternehmen unbedingt erforderlich. Zunächst sollen jedoch die quantitativen Merkmale und die Bedeutung von KMU in Deutschland Gegenstand näherer Ausführungen sein.
Zur Definition von KMU werden in der Literatur theoretische (qualitative) und operationale (quantitative) Merkmale angeführt (Henschel 2008b, S. 10). Quantitative Kriterien sind einfach operationalisierbar, statistisch verfügbar und präzisieren gewisse Umstände exakt (Hartmann, Schenkel 2002, S. 25). Dennoch besteht keine einheitliche Definition für KMU, die für alle Anwendungsbereiche Gültigkeit hat und es sind je nach Zweck verschiedene Merkmale zur Abgrenzung der KMU von anderen Unternehmen denkbar.
Von Bedeutung für KMU in Deutschland ist in Wissenschaft und Praxis die quantitative Definition des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung (IFM). Danach sind Unternehmen mit bis zu neun Beschäftigten und weniger als einer Million Euro Jahresumsatz kleine Unternehmen. Als mittlere Unternehmen werden solche mit zehn bis 499 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von einer Million bis unter fünfzig Millionen Euro bezeichnet. KMU sind demnach Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten und fünfzig Millionen Euro Jahresumsatz. Legt man diese Definition zugrunde, zählen nach aktuellen Zahlen des IFM 99,7 Prozent der Unternehmen in Deutschland zu den KMU. Auf sie entfallen 37,5 Prozent aller steuerpflichtigen Umsätze. Des Weiteren sind KMU die Arbeitgeber von 70,5 Prozent aller Beschäftigten bzw. 65,8 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland. Bemerkenswert ist auch, dass sie ganze 83,1 Prozent aller Auszubildenden beschäftigen. An der Nettowertschöpfung der Unternehmen halten KMU einen Anteil von 47,3 Prozent (IFM Bonn 2009).
Die statistischen Zahlen verdeutlichen die wirtschaftliche Bedeutung kleiner und mittelständischer Unternehmen, was aber nicht heißt, dass deren Bedeutung alleine hiervon abhängt. Den KMU wird darüber hinaus auch eine starke ordnungs-, kultur- und sozialpolitische Funktion zugesprochen (Hartmann Schenkel 2002, S. 10–11). In der Einleitung wurden die erschreckenden Zahlen von Unternehmensinsolvenzen seit Beginn der Finanzkrise angesprochen. Aus den statistischen Tabellen des IFM geht hervor, dass die Insolvenzen von Einzelunternehmen, Personengesellschaften und GmbHs – hierbei handelt es sich im Wesentlichen um KMU (Weilep 2008, S. 11) – im Jahr 2008 zusammen 95,9 Prozent betrugen (IFM Bonn 2009). Es stellt sich die Frage, warum Unternehmen mit solch enormer Bedeutung einem so hohen Insolvenzrisiko ausgesetzt sind. Diese Frage können u. a. qualitative Merkmale von KMU beantworten.
Quantitative Merkmale haben den Nachteil, dass sie die Charakteristika von KMU nicht ausreichend hervorheben. Diesen Nachteil beseitigen qualitative Merkmale, wobei jedoch durch deren erschwerte Operationalisierbarkeit eine statistische Vergleichbarkeit kaum möglich ist (Hartmann Schenkel 2002, S. 25).
In qualitativer Hinsicht weisen KMU im Vergleich zu Großunternehmen Besonderheiten hinsichtlich der Eigner-, Risiko-, Führungs-, Organisations- und Informationsstruktur sowie Ressourcenbeschränkungen auf. Dies hat Auswirkungen auf die Ausgestaltung formaler Planungs-, Steuerungs- und Kontrollsysteme (PSK-Systeme) bzw. Rechnungswesensysteme sowie auf das funktionale und institutionelle Controlling (Winter 2008, S. 77).
Aufgrund der engen Beziehung zwischen Eigentum und Führung ist die Führungs- und Organisationsstruktur oftmals inhaberbezogen. Dies äußert sich in wenigen Hierarchieebenen, breiten Leistungsspannen und geringer Arbeitsteilung, aber zugleich hoher Spezialisierung. Die Folge sind kurze Informationswege, ausgeprägte persönliche Koordination und eine hohe Flexibilität. Darin liegen die Erfolgspotenziale von KMU. Demgegenüber stehen aber auch Risiken. Führungskräfte sind oftmals mit operativen Aufgaben überlastet, was zu Schwächen in der strategischen Planung führt. Es bestehen Mängel bezüglich der verfügbaren Kenntnisse, Systeme und Kapazitäten bzw. der verfügbaren Ressourcen. Da die geringe Unternehmenskomplexität die Notwendigkeit formalisierter Strukturen verringert, weisen systematische Planungen und formale PSK-Systeme tendenziell einen geringen Entwicklungsstand auf. Wie bereits angedeutet, korreliert die Institutionalisierung, aber auch die Professionalität des Controllings stark mit der Unternehmensgröße (Winter et al. 2006, S. 174). Managementfehler – vor allem strategische Fehlentscheidungen – und Schwächen in der Unternehmensstruktur – insbesondere fehlende formalisierte Strukturen – zählen zu den häufigsten Insolvenzursachen. Diese Risiken treten hauptsächlich in den ersten sieben Jahren nach der Gründung des Unternehmens auf (Henschel 2008a, S. 82).
Außerdem ist die Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch größtenteils nur unzureichende Nachfolgeregelungen gefährdet. Neben diesem existenzgefährdenden Personalrisiko, dessen Ursache die Unternehmensführung selbst ist, bergen auch Mitarbeiterverluste enormes Risikopotenzial. In KMU hat ein einzelner Mitarbeiter einen höheren Anteil an der Gesamtarbeitsleistung, da im Vergleich zu Großunternehmen die absolute Mitarbeiterzahl geringer ist. Damit einhergehend ist ein höherer Beitrag zur unternehmerischen Wertschöpfung. Ein Mitarbeiterverlust, verursacht durch Krankheit, Unfall, Tod oder Kündigung, stellt daher ein hohes Risiko für KMU dar (Wildemann 2005, S. 237).
Ein weiteres existenzgefährdendes Risiko ist das Finanzierungsrisiko. Die Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ist hochgradig abhängig von der Finanzierung mit Bankkrediten (Behr und Fischer 2005, S. 2). Bedingt durch die Wahl der Rechtsform (Einzelunternehmen, Personengesellschaften und GmbHs) und der meist nur ansatzweise vorhandenen formalen bzw. systematischen Unternehmensplanung, ist der Zugang zum Kapitalmarkt beschränkt. „Neben der Selbstfinanzierung überwiegt die Fremdfinanzierung“ (Wildemann 2005, S. 237). Daher verfügen KMU über eine niedrige Eigenkapitalquote. Diese wird jedoch immer mehr zu einem Entscheidungskriterium, wenn es um die Kreditvergabe und deren Konditionen geht. Wie später noch ausführlich erläutert wird, bestimmt die Eigenkapitalquote maßgeblich die Bonitätsbewertung bzw. die bankinterne Ratingeinstufung. Ein weiterer Grund für die niedrige Eigenkapitalquote in KMU ist aus bilanzieller Sicht der „finanzielle Überbau“. Dies bedeutet, dass die Bilanzpositionen Forderungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite zunehmen und auf der Aktivseite die Position Anlagevermögen abnimmt. Dabei dominieren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen das Umlaufvermögen. Zunehmende Zahlungsverzögerungen und Forderungsausfälle sind Risiken, die die Liquidität und Rentabilität der KMU massiv gefährden. Die Konsequenz hieraus ist, dass die Unternehmen über immer weniger Eigenkapital verfügen, das sie in konjunkturell schwachen Zeiten dringend für Investitionen in das Anlagevermögen benötigen. Die Kombination aus Zahlungsausfällen von externen Marktpartnern und Ertragsrückgängen infolge einer schwachen Konjunktur vermindert den Cashflow und führt zu einer weiteren Senkung der Eigenkapitalquote (Rödl 2006, S. 114–115).
Neben der finanziellen Abhängigkeit von Marktpartnern zeigen sich weitere Abhängigkeiten auch in Kunden-Lieferanten-Beziehungen. Ein Großteil der deutschen KMU sind spezialisierte Zulieferer für Großunternehmen. Die Zulieferbeziehungen gehen oftmals so weit, dass eine Selbstständigkeit von KMU nicht mehr gegeben ist. Durch ihre kundenindividuelle, problemlösungsorientierte Leistungserstellung sind KMU nur unzureichend diversifiziert und konzentrieren sich auf Nischenmärkte, in denen die Substitutionsgefahr durch die Konkurrenz groß ist. Der Wegfall eines Großkunden kann für ein KMU daher ebenfalls eine Existenzgefährdung bedeuten.
Zusammenfassend lassen sich aus den qualitativen, KMU-spezifischen Merkmalen vier existenzgefährdende Risiken ableiten, die die Risikoursachen weiterer Folgerisiken sein können:
Managementfehler des Eigentümer-Unternehmers aufgrund der Überlastung durch operative Aufgaben, fehlender Erfahrung und fehlender formalisierter Strukturen als Informationsbasis für Entscheidungen (Unternehmerrisiko)
Der Ausfall von Schlüsselpersonal (auch des Unternehmers selbst), das einen hohen Anteil an der unternehmerischen Wertschöpfung hat (Personalrisiko)
Illiquidität aufgrund verwehrter Kreditvergabe, fehlenden alternativen Finanzierungsmöglichkeiten und zunehmenden Forderungsausfällen in konjunkturell schwachen Zeiten...