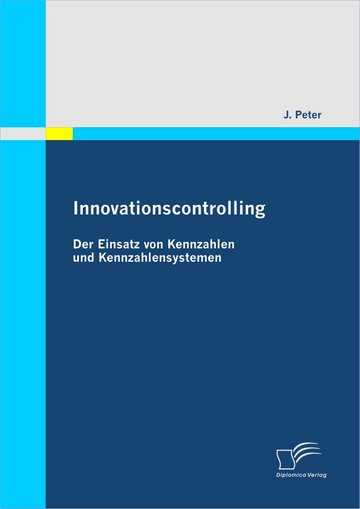| Inhaltsverzeichnis | 3 |
| Abbildungsverzeichnis | 5 |
| Abkürzungsverzeichnis | 6 |
| 1. Einleitung | 7 |
| 1.1 Einführung in die Problematik | 7 |
| 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit | 7 |
| 2. Erfolgsfaktor Innovationen | 9 |
| 2.1 Definition und Abgrenzung des Innovationsbegriffs | 9 |
| 2.2 Merkmale einer Innovation | 9 |
| 2.3 Innovationsarten | 10 |
| 3. Innovationscontrolling und Kennzahlen | 11 |
| 3.1 Grundlegende Aufgaben und Ziele des Controlling | 11 |
| 3.1.1 Differenzierte Controlling-Konzeptionen | 11 |
| 3.1.2 Abgrenzung Management und Controlling | 13 |
| 3.2 Inhalt und Funktionen des Innovationscontrolling | 13 |
| 3.2.1 Wesentliche Problembereiche | 14 |
| 3.2.2 Anforderungen an ein umfassendes Innovationscontrolling | 14 |
| 3.3 Charakterisierung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen | 15 |
| 3.3.1 Funktion und Klassifizierungsmöglichkeiten vonKennzahlen | 16 |
| 3.3.2 Kennzahlensysteme: Merkmale und Erscheinungsformen | 17 |
| 4. Aufbau und Phasen des Innovationsprozesses | 18 |
| 4.1 Klassische Phasenmodelle | 19 |
| 4.2 Moderne Phasenmodelle | 19 |
| 4.3 Erweiterte Phasenmodelle | 20 |
| 5. Innovationsprozess und Innovationscontrolling | 22 |
| 5.1 Abgrenzung Innovations-, FuE- und Marketingcontrolling | 22 |
| 5.2 Strategische Innovationsplanung | 23 |
| 5.2.1 Ableitung des Innovationsbedarfs | 23 |
| 5.2.2 Ableitung von Innovationsstrategien | 26 |
| 5.2.3 Ableitung und Auswahl von Innovationsideen | 27 |
| 5.2.4 Bewertung von Innovationsideen | 30 |
| 5.2.5 Ideenumsetzung | 34 |
| 5.3 Operative und strategische Kontrolle der Produktumsetzung | 37 |
| 5.4 Zwischenfazit | 38 |
| 6. Kennzahlengestützes Innovationscontrolling | 39 |
| 6.1 Beurteilung vorhandener Kennzahlen und Kennzahlensysteme in Bezug auf Innovationen | 39 |
| 6.2 Kennzahlen zur Unterstützung des Innovationscontrolling | 40 |
| 6.2.1 Anforderungen an Innovationskennzahlen | 40 |
| 6.2.2 Innovationsprozessbezogene Kennzahlen | 42 |
| 6.2.3 Innovationsprojektbezogene Kennzahlen | 44 |
| 6.3 Innovationscontrolling als Performance Measurement (PM) | 45 |
| 6.3.1 Performance Measurement Systeme vs. Traditionelle Kennzahlensysteme | 45 |
| 6.3.2 Grundkonzept von Performance Measurement Systemen | 47 |
| 6.3.3 Innovation Scorecard als PM-System | 49 |
| 7. Kritische Würdigung und Ausblick | 57 |
| Literaturverzeichnis | 59 |