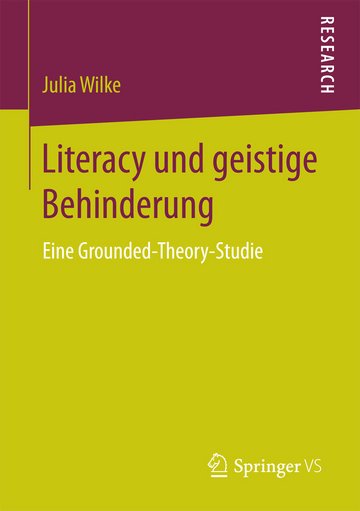| Vorwort und Dank | 5 |
| Inhaltsverzeichnis | 7 |
| Tabellenverzeichnis | 11 |
| Abbildungsverzeichnis | 13 |
| Abkürzungsverzeichnis | 14 |
| 1 Einleitung | 16 |
| Teil A – Theoretische Grundlagen | 21 |
| 2 Literacy – Begriffliche Annäherungen | 22 |
| 2.1 Literacy-Verständnis der Elementarpädagogik | 22 |
| 2.2 Metaphorischer Gebrauch | 25 |
| 2.3 Die New Literacy Studies | 26 |
| 2.4 Literacy-Begriff in der Geistigbehindertenpädagogik und Darlegungdes Verständnisses für die vorliegende Arbeit | 31 |
| 3. Lesen und Literaturerfahrung – Tradition undWandel | 35 |
| 3.1 Die „Demokratisierung“ des Lesens bzw. der literarischen Kultur | 37 |
| 3.2 Lesen im 20. und 21. Jahrhundert | 42 |
| 3.2.1 Analphabetismus | 43 |
| 3.2.2 Lesen und Literatur im Kontext medialer Vielfalt | 44 |
| 3.3 Lesen als Freizeitbeschäftigung | 49 |
| 3.3.1 Exkurs: Freizeitentwicklung | 49 |
| 3.3.2 Freizeitbeschäftigungen im Zeitvergleich | 50 |
| 3.3.3 Ergebnisse der Leserforschung | 52 |
| 3.4 Schlussfolgerungen – Die Vielfalt der Lesekultur | 54 |
| 4. Menschen mit geistiger Behinderung im Kontextvon Lesen und Literatur | 57 |
| 4.1 Optionale Bildungsverläufe von Menschen mit geistiger Behinderung | 58 |
| 4.1.1 Frühe Bildung und Frühförderung | 61 |
| 4.1.2 Schulische Bildung | 64 |
| 4.1.3 Bildung im Erwachsenenalter | 75 |
| 4.1.4 Zusammenfassung | 83 |
| 4.2 Kulturelle Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung | 84 |
| 4.2.1 Leichte Sprache | 87 |
| 4.2.2 Leitprinzipien der Bildung und Begleitung von Menschen mit geistigerBehinderung | 89 |
| 4.2.2.1 Das Prinzip der Normalisierung | 90 |
| 4.2.2.2 Selbstbestimmung und Empowerment | 92 |
| 4.2.2.3 Teilhabe und Inklusion | 93 |
| 4.2.3 Zusammenfassung | 95 |
| 5. Desiderat und Fragestellung | 97 |
| Teil B – Empirischer Teil | 99 |
| 6. Empirische Forschung mit Menschen mit geistigerBehinderung | 100 |
| 1.1 Quantitative Forschung im Kontext geistiger Behinderung | 101 |
| 1.2 Qualitative Forschung im Kontext geistiger Behinderung | 105 |
| 1.3 Qualitative Datenerhebungsmethoden im Forschungskontext geistigerBehinderung | 106 |
| 1.3.1 Befragungen von Menschen mit geistiger Behinderung | 107 |
| 1.3.1.1 Intervieweffekte | 108 |
| 1.3.1.2 Hinweise zur Durchführungspraxis qualitativer Interviews | 113 |
| 1.3.1.3 Zusammenfassung | 117 |
| 1.3.2 Teilnehmende Beobachtung | 118 |
| 1.3.2.1 Chancen und Probleme nach Angrosino (2004) | 120 |
| 1.3.2.2 „Anwendungsrestriktionen“ nach Lamnek (2005) | 123 |
| 1.3.2.3 Zusammenfassung | 126 |
| 7. Forschungsmethodisches Design I – Quantitative Teilstudie | 128 |
| 2.1 Einordnung der Studie in das Feld der quantitativen Forschung | 129 |
| 2.2 Methodisches Vorgehen | 130 |
| 2.3 Stichprobe | 132 |
| 8. Deskriptive Auswertung der quantitativenForschungsergebnisse | 135 |
| 3.1 Lesefertigkeiten – Darstellung und Diskussion der Ergebnisse | 135 |
| 3.2 Mediennutzung – Darstellung und Diskussion der Ergebnisse | 140 |
| 3.2.1 Die Diskrepanz zwischen den Wohnformen | 147 |
| 3.2.3 Das Angebot bestimmt die Nachfrage | 149 |
| 3.3 Zwischenfazit | 150 |
| 9. Forschungsmethodisches Design II – QualitativeTeilstudie | 152 |
| 4.1 Grounded Theory Methodology | 153 |
| 4.1.1 Zirkulärer Forschungsprozess | 155 |
| 4.1.2 Vergleichende Analyse (Comparative Analysis) | 155 |
| 4.1.3 Kodieren | 156 |
| 4.1.4 Theoretisches Sampling und Theoretische Sättigung | 158 |
| 4.2 Untersuchungsdesign der qualitativen Studie | 158 |
| 4.2.1 Feldzugang | 159 |
| 4.2.2 Sample | 161 |
| 4.2.3 Überblick über das Datenmaterial und die Erhebungsmethoden | 163 |
| 4.2.3.1 Feldphase und Dokumentationstechnik | 165 |
| 4.2.3.2 Interviewform | 166 |
| 4.2.3.4 Zur Auswahl der Gesprächspartner | 169 |
| 10. Darstellung der Ergebnisse auf Einzelfallebene | 172 |
| 5.1 Herr Nägler – Literacy als Attribut des angestrebten Lebensstils | 174 |
| 5.2 Herr Lindhorst – Literacy als Normalisierung und Ausdruck von Bildung | 185 |
| 5.3 Herr Winkelmann – Literacy als Merkmal von Erwachsensein und Bildung | 196 |
| 5.4 Zusammenfassende Übersicht der Schlüsselkategorien derEinzelfalldarstellungen | 207 |
| 11. Darstellung der Ergebnisse derfallübergreifenden Auswertung | 210 |
| 6.1 Repräsentative Funktion | 210 |
| 6.2 Kommunikative Funktion | 222 |
| 6.2.1 Rituale zwischen individueller Ordnung und äußerem Kennzeichen | 222 |
| 6.1.1 Repräsentation von Bildung | 211 |
| 6.1.1.1 Das Buch als Vehikel | 212 |
| 6.1.1.2 Arbeit und Beruf als Repräsentanten von Bildung | 215 |
| 6.1.2 Repräsentation von Seriosität | 217 |
| 6.1.3 Exkurs: Repräsentation von Normalität | 220 |
| 6.3 Distinktive Funktion | 226 |
| 6.3.1 Räumlich-soziale Abgrenzung | 227 |
| 6.3.2 Abgrenzung von anderen | 228 |
| 6.3.3 Hervorhebung durch Betreuungspersonal | 228 |
| 6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der fallübergreifenden Analyse | 230 |
| 12. Theoretischer Zwischenteil | 232 |
| 7.1 Identität/Selbst | 232 |
| 7.1.1 Zum Begriff „Identität“ | 233 |
| 7.1.2 Das Identitätskonzept nach Goffman | 235 |
| 7.1.3 Weitere Identitätskonzepte | 238 |
| 7.1.4 Identität und geistige Behinderung | 239 |
| 7.2 Selbstdarstellung | 240 |
| 7.3 Distinktion | 243 |
| 13. Formulierung einer gegenstandsbezogenen Theorie: Literacy, Bildung, Identität – und dasStreben nach Respekt | 249 |
| 14. Diskussion der Ergebnisse | 252 |
| 9.1 Annäherung an das Hochkulturschema bzw. Niveaumilieu | 253 |
| 9.2 Theorie der symbolischen Selbstergänzung | 256 |
| 9.3 Zusammenfassung | 260 |
| 15. Ausblick und Abschluss | 261 |
| Literaturverzeichnis | 267 |