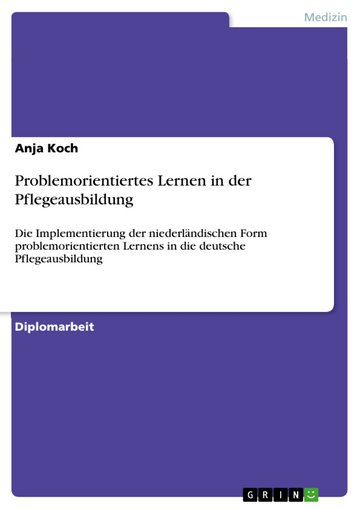In den Niederlanden hat sich das problemorientierte Lernen seit Mitte der siebziger Jahre in den verschiedenen Fachrichtungen ausgebreitet und erreichte auch die neu gegründeten Fachhochschulen für Pflege. Die praktische Ausbildung fand weiterhin direkt am Krankenbett statt. Es kam von daher schnell zu Kritik von Seiten der Pflegepraxis, da die kognitive Wissensaneignung und die Problemanalysefähigkeit, die durch das problemorientierte Lernen gefördert wurden, dem bei der Berufsausübung notwendigen Handeln in Pflegesituationen wenig gerecht wurde (vgl. Ludwig 2004, S. 92).
Aufgrund dieser Kritik wurde das „Maastrichter Unterrichtsmodell“ in die Krankenpflegeausbildung eingeführt. Dieses besteht aus drei Komponenten: dem problemorientierten Unterricht als theoretischem Teil der Ausbildung, dem Skillslab-Unterricht zum Erlernen der praktischen Fertigkeiten sowie der fachbezogenen Studienlandschaft, in welcher die Studenten optimal eigenständig studieren können (vgl. van Meer 2001, S. 1).
Diese drei Bestandteile werden im Folgenden näher dargestellt. Zum besseren Verständnis der Rahmenbedingungen des problemorientierten Lernens wird zunächst die niederländische Krankenpflegeausbildung beschrieben.
Mitte der neunziger Jahre begann in den Niederlanden eine Umstrukturierung der Krankenpflegeausbildung mit dem Ziel der Verbesserung, der Angleichung an die Anforderungen des Gesundheitswesens sowie dem flexibleren Einsatz der Schüler (vgl. Lahmann et al. 1998, S. 257).
1997 wurde infolgedessen die niederländische Krankenpflegeausbildung neu geregelt. Es entstanden innerhalb des Pflege- und Versorgungsbereiches vier Berufe mit gesonderten Ausbildungsgängen (vgl. Rennen-Allhoff/Bergmann-Tyacke 2000, S. 57):
Pflegehelfer in der Heim- und häuslichen Pflege,
Sozialpfleger in der Heim- und häuslichen Pflege,
Krankenschwester/Krankenpfleger Qualifikationsniveau 4,
Krankenschwester/Krankenpfleger Qualifikationsniveau 5
Die Beschreibung des Niveaus richtet sich laut Lahmann et al. nach den drei Kompetenzkriterien Verantwortlichkeit, Komplexität sowie Transfer. Je höher die Qualifikationsstufe ist, desto höher ist die Kompetenz der Pflegekraft. So entspricht beispielsweise der Pflegehelfer in der Heim- und häuslichen Pflege dem derzeit niedrigsten Qualifikationsniveau zwei. Dieses ist durch Routine- und Standardarbeiten gekennzeichnet. Die Ausbildung dazu dauert zwei Jahre, als Qualifikationsstruktur wird die Unterstützung bei der Pflege angegeben. Als Zugangsvoraussetzung gilt die Grundstufe, welche dem deutschen Hauptschulabschluss gleichzusetzen ist (vgl. Lahmann et al. 1998, S. 258ff.).
Das nächst höhere Qualifikationsniveau nehmen die Sozialpfleger in der Heim- und häuslichen Pflege ein. Ihre Aufgabe liegt laut Rennen-Allhoff und Bergmann-Tyacke in der Pflege körperlich eingeschränkter und psychisch Kranker, die in ihrem Umfeld oder in alternativen Einrichtungen Hilfe benötigen. Hier ist ein mittlerer Bildungsabschluss Voraussetzung (vgl. Rennen-Allhoff/Bergmann-Tyacke 2000, S. 57).
Sowohl die Ausbildung der Sozialpfleger als auch die der Krankenschwestern/Krankenpfleger im Qualifikationsniveau vier finden an Berufsfachschulen im Rahmen der sekundären Berufsausbildung statt. Unterschiede gibt es sowohl in der Ausbildungslänge als auch im Aufgabenbereich.
Während sich die Sozialpfleger drei Jahre in Ausbildung befinden, werden die Pflegekräfte aus dem vierten Niveau ein Jahr länger ausgebildet. Die Zugangsvoraussetzungen sind gleich. Die Krankenschwestern/Krankenpfleger im Qualifikationsniveau vier sind für die eigenverantwortliche Planung und Durchführung der Pflege von Patienten verantwortlich.
Die höchste Qualifikation der niederländischen Krankenpflegeausbildung findet im tertiären Bildungsbereich statt, an so genannten „Hogeschoolen“, was als Zugangsvoraussetzung einen höheren Sekundarabschluss verlangt (vgl. ebd. S. 57).
Dieser umfasst eine elfjährige Schulbildung und entspricht der Fachhochschulreife (vgl. Dielmann 1999, S. 258).
Auch hier dauert die Ausbildung vier Jahre. In dieser Zeit sollen die zukünftigen Krankenschwestern und Krankenpfleger dazu ausgebildet werden, in neuen Situationen angemessen zu handeln, beratend und organisatorisch tätig zu sein sowie zur Verbesserung der Bedingungen in der Pflege beitragen zu können (vgl. Rennen-Allhoff/Bergmann-Tyacke 2000, S. 58).
In dieser Qualifikationsstufe findet das Maastrichter Unterrichtsmodell Anwendung. Der zeitliche Umfang beträgt 6650 Stunden, wobei 4100 Stunden auf den theoretischen Unterricht fallen und 2550 Stunden auf die praktischen Einsätze (vgl. Wendt-Leon 1995, S. 90).
Der Abschluss dieses Ausbildungsniveaus kann laut Dielmann als erste Stufe eines Hochschulabschlusses eingeschätzt werden (vgl. Dielmann 1999, S. 260).
In den Niveaustufen drei, vier und fünf ist im letzten Abschnitt der Ausbildung eine Spezialisierung in vier Bereichen möglich (vgl. Rennen-Allhoff/Bergmann-Tyacke 2000, S. 58). Diese sind:
1. Kurzzeitpflege bei akuten Erkrankungen und Unfällen,
2. Pflege bei Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Pflege von Kindern und Jugendlichen,
3. Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, Alten- und Behindertenpflege,
4. chronisch Kranke.
Die Krankenpflegeausbildung kann auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen: entweder berufsausbildend mit Studium und Praktika oder berufsbegleitend mit Arbeit und Teilzeitunterricht.
Die praktischen Einsätze finden in den verschiedenen Einrichtungen des Gesundheitswesens statt (vgl. ebd. S. 59).
In den Niederlanden wurde für die Krankenpflegeausbildung in allen Bereichen ein landesweit geltender Rahmenlehrplan erstellt. Des Weiteren wurde die Ausbildung modularisiert und die Fächerorientierung aufgehoben (vgl. Brüggemann 2004, S. 651).
Die Ausbildung der Lehrkräfte erfolgt in Form eines zweijährigen Weiterbildungsstudiums im tertiären Bildungsbereich. Dazu wird eine abgeschlossene Krankenpflegeausbildung vorausgesetzt sowie eine einjährige Berufserfahrung. Die Lehrbefähigung bezieht sich aber nur auf den Pflegeunterricht (vgl. Rennen-Allhoff/Bergmann-Tyacke 2000, S. 59).
Studenten mit einem mittleren Ausbildungsabschluss in einem pflegerischen Beruf studieren zwei Jahre in Teilzeit, Studenten mit einem Fachhochschulabschluss dagegen nur ein Jahr ebenfalls in Teilzeit. Das Studium beinhaltet keine pflegetheoretischen Aspekte, sondern bezieht sich hauptsächlich auf Didaktik, Fachdidaktik und angrenzende Themenschwerpunkte wie beispielsweise betriebliche Bildung. Nach dem Studium können die Absolventen zwei Richtungen verfolgen, zum einen als Lehrer für Pflege, zum anderen als Praxisausbilder in Einrichtungen des Gesundheitswesens (vgl. Brüggemann 2004, S. 654).
Wie die neuesten Ausführungen zur Ausbildung von Lehrern für Pflege in den Niederlanden zeigen, wird hier an einer Umstellung der Curricula in Richtung des kompetenzorientierten Lernens gearbeitet (vgl. ebd. S. 651).
Nachdem in diesem Abschnitt die Krankenpflegeausbildung sowie die Ausbildung der Lehrer dargestellt wurde, werden im Folgenden die Elemente des Maastrichter Unterrichtsmodells, beginnend mit der problemorientierten Lernform, vorgestellt.
Neben dem Skillslab-Unterricht und der fachbezogenen Studienlandschaft ist der problemorientierte Unterricht das dritte Element des Maastrichter Unterrichtsmodells (vgl. van Meer 2001, S. 1). Er umfasst insgesamt 60 % der Ausbildung (vgl. van Meer 1994, S. 81).
Zunächst werden im folgenden Abschnitt die verschiedenen Aufgabentypen beschrieben, die im problemorientierten Unterricht Anwendung finden.
Den wichtigsten Aspekt des problemorientierten Lernens stellt die Problemaufgabe dar. Es gibt darüber hinaus noch andere Aufgabentypen, die es ermöglichen sollen, dass die Studenten das neu erworbene Wissen auf andere Situationen übertragen können sowie der Meinungsbildung der Studenten zu bestimmten berufsrelevanten Themen dienen sollen. Dazu zählen die Diskussionsaufgabe, die Strategieaufgabe, die Studiumsaufgabe sowie die Anwendungsaufgabe (vgl. van Meer 1994, S. 85).
Diskussionsaufgaben werden nach Moust et al. in den Unterricht eingefügt, um das kritische Urteilsvermögen zu fördern. Inhalte dieser Diskussionen können berufliche, aber auch allgemeine gesellschaftliche Aspekte sein. Dieser Aufgabentyp soll zum einen die Studenten mit verschiedenen Meinungen zum Thema vertraut machen und zum anderen sollen sie lernen,...